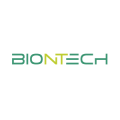Wie entwickelt sich der Life Science Standort Mittelhessen?
Der VDI Mittelhessen und das Regionalmanagement Mittelhessen laden am 20. März 2025 auf die High-Tech Messe W3+ Fair in Wetzlar ein. Diskutieren Sie mit, über die Bedeutung der Schlüsselbranche Life Science für den Standort.
Das vollständige Programm und Anmeldung finden Sie hier.
Healthcare-Storys
Am Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE) am Uniklinikum Marburg finden Betroffene Hilfe bei Prof. Jürgen Schäfer.
Artikel lesen
DFG Präsidentin Prof. Dr. Katja Becker hat ihr Forscherleben vor allem einem Ziel gewidmet: neue Wirkstoffe und Diagnostika gegen armutsassoziierte und vernachlässigte Infektionskrankheiten zu entwickeln.
Artikel lesen
Millionen Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen gehören zur Corona-Risikogruppe. Eine neue Inhalationsmethode, die gerade in Marburg entwickelt wird, hat Potenzial als innovative Therapiemöglichkeit.
Artikel lesen
Am Anfang einer Existenzgründung steht eine gute Idee. Aber sie ist nur ein Aspekt zum Unternehmenserfolg. Im Interview erklärt Jens Fürbeth von der Volksbank Mittelhessen, was gute Finanzberatung für Healthcare-Startups ausmacht.
Artikel lesen
Die Insektenforschung ist eine Gießener Erfolgsstory. Experten versprechen sich davon innovative Lösungen für globale Herausforderungen. Das Land Hessen stellt nun weitere Fördermittel für die Region bereit.
Artikel lesen
Die neue MacTRAP Mauslinie ermöglicht Forschern die bisher verborgen gebliebenen Nieren-Makrophagen näher zu untersuchen. Somit eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Diagnose von entzündlichen Erkrankungen.
Artikel lesen
SPANNENDE STORY? INNOVATIVER SERVICE?
Wir bringen Ihren Content auf den Blog für die Medizinwirtschaft in Mittelhessen.
Kontaktieren Sie uns.