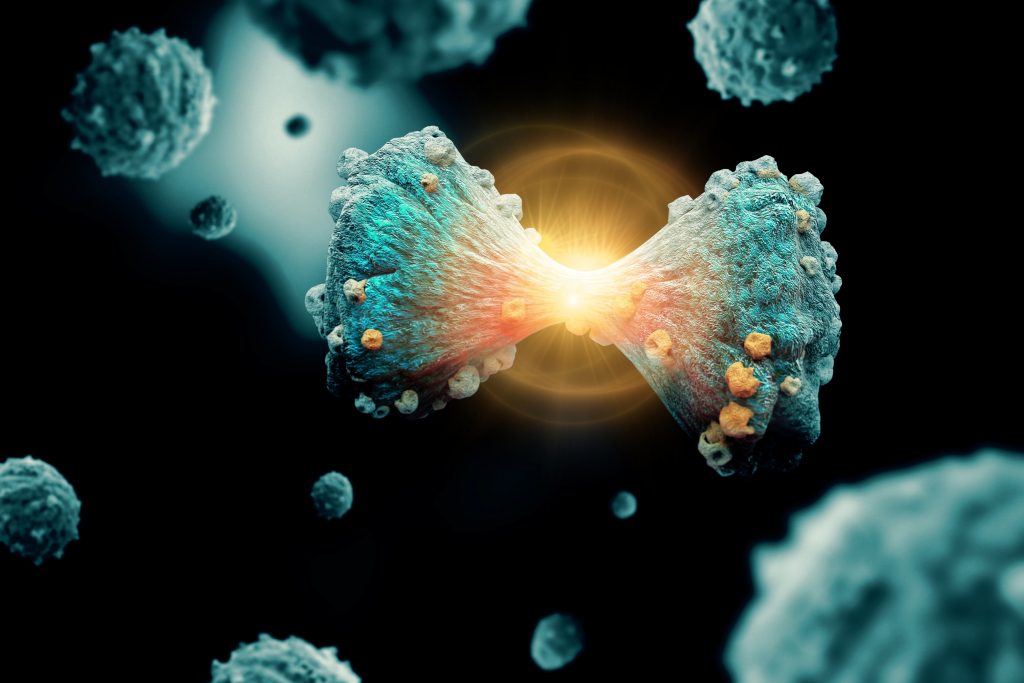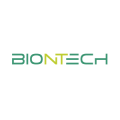Wie entwickelt sich der Life Science Standort Mittelhessen?
Der VDI Mittelhessen und das Regionalmanagement Mittelhessen laden am 20. März 2025 auf die High-Tech Messe W3+ Fair in Wetzlar ein. Diskutieren Sie mit, über die Bedeutung der Schlüsselbranche Life Science für den Standort.
Das vollständige Programm und Anmeldung finden Sie hier.
Healthcare-Storys
Die Marburger Wissenschaftlerin Dr. Nadine Biedenkopf forscht an Mitteln gegen gefährliche Viren, wie Ebola. Silvestrol macht Hoffnung.
Artikel lesen
Neben Operation, Strahlen- und klassischer Chemotherapie kommen zunehmend gezielt wirkende und individuell auf den Patienten zugeschnittene Medikamente (targeted therapies) zum Einsatz.
Artikel lesen
Viele Menschen weltweit schnarchen. Schnarchen kann jedoch ein Anzeichen für eine Schlafapnoe sein, welche unbehandelt zu einem gestiegenen Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko führt. In Marburg forschen Experten an Therapieverfahren für solche Schlaf- und Atmungsstörungen.
Artikel lesen
Die Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen: E-Health verbindet neuste IT-Technologien und Medizin. Das Ziel ist eine patientengerechte und zeitgemäße, moderne Versorgung.
Artikel lesen
Früherkennung kann bei einer Krebserkrankung Leben retten. Die Laser-Mikrodissektion ermöglicht gezielte Zelluntersuchungen und eine präzise Krebsforschung.
Artikel lesen
In Mittelhessen stellen sich Forscher dem Kampf gegen die Antibiotika-Resistenzen und suchen neue Wege zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten.
Artikel lesen
SPANNENDE STORY? INNOVATIVER SERVICE?
Wir bringen Ihren Content auf den Blog für die Medizinwirtschaft in Mittelhessen.
Kontaktieren Sie uns.